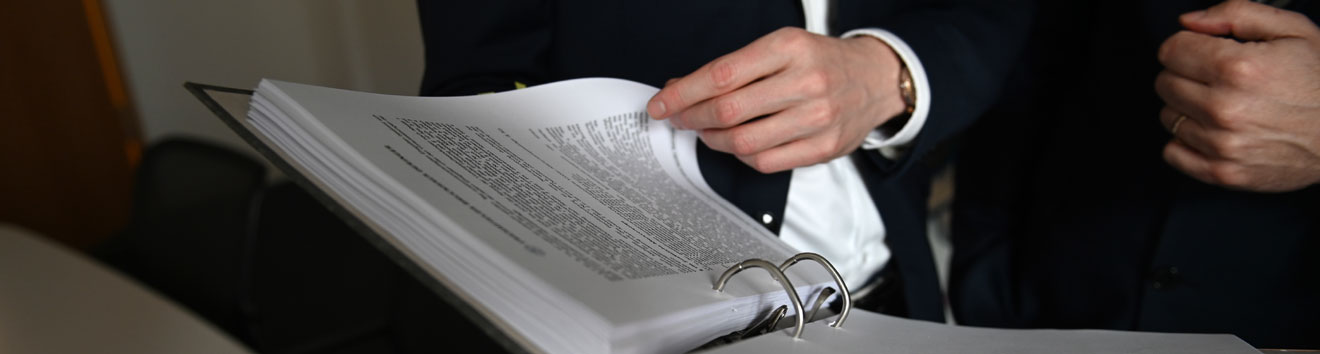In seinem nunmehr veröffentlichten Beschluss vom 19. Mai 2021 – 1 StR 496/20 – hat der 1. Strafsenat des BGH das Erfordernis konkreter Bezifferung und Feststellung des Vermögensschadens i.S.d. § 263 Abs. 1 StGB erneut klar herausgestellt. Wiederholt knüpft der BGH damit an die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 zur Erforderlichkeit der Ermittlung eines konkreten Vermögensnachteils bei der Untreue gem. § 266 StGB (BVerfGE 126, 170) an. Danach hat die Schadensfeststellung in wirtschaftlich nachvollziehbarer Weise und unter Berücksichtigung anerkannter Bewertungsverfahren und -maßstäbe zu erfolgen. Nichts anderes gilt, wie der 1. Strafsenat in seiner Entscheidung einmal mehr betont, für die Schadensfeststellung im Rahmen des Betrugstatbestands.
Der aktuellen Entscheidung des BGH liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die beiden Angeklagten waren nacheinander zum Vorstand einer Aktiengesellschaft bestellt worden, die mit Immobilien, unternehmerischen Beteiligungen, Versicherungen, Kapitalanlagen und Forderungen handelte. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte unter anderem durch die Abtretung vinkulierter Namensaktien – zunächst über eine Drittgesellschaft, später durch die Aktiengesellschaft als Zedentin selbst. Obgleich die Angeklagten spätestens im Oktober 2009 die Zahlungsunfähigkeit der Aktiengesellschaft sowie der Drittgesellschaft gekannt bzw. es für möglich gehalten hatten, dass die Aktiengesellschaft die vertraglich vereinbarte Rücknahme der abgetreten Aktien nicht mehr erfüllen könne und daher die Rückzahlung von Kapital und Zinserträgen an die Anleger konkret gefährdet sein würde, verkauften sie weitere Aktien im Gesamtwert von ca. 1,3 Mio. Euro.
Der BGH hat die Verurteilung der beiden Angeklagten wegen Betrugs aufgehoben, weil das Tatgericht nach Ansicht des Senats den Eintritt eines Vermögensschadens bei den Anlegern i.S.d. § 263 Abs. 1 StGB nicht hinreichend belegt hat.
Er führt im Einzelnen aus, dass das Tatgericht es versäumt hat, die nach der Definition des Vermögensschadens erforderliche Bestimmung des wirtschaftlichen Wertes der Rückzahlungsansprüche festzustellen. Da ein Vermögensschaden i.S.d. § 263 Abs. 1 StGB nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung nur eintritt, wenn die Vermögensverfügung des Getäuschten bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise unmittelbar zu einer nicht durch Zuwachs ausgeglichenen Minderung des Gesamtwertes seines Vermögens führt, waren diesbezügliche Feststellungen unverzichtbar. Maßgeblich ist nach ständiger Rechtsprechung dabei auf den Zeitpunkt der Vermögensverfügung abzustellen, es ist also ein der Vergleich der Vermögenswerte unmittelbar vor und nach der Verfügung vorzunehmen. In Fällen mutmaßlichen Anlagebetrugs ist danach dem geleisteten Anlagebetrag der gleichzeitig erlangte Rückzahlungsanspruch gegenüberzustellen. Die Bestimmung dieses Forderungswertes hat – „wie auch sonst beim Vermögensvergleich“ – unter wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu erfolgen und ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkret festzustellen und zu beziffern. Derartige Ausführungen enthielt das Urteil des LG indes nicht.
Der Senat stellt klar, dass es ist nicht ausreicht, allein auf die Zahlungsunfähigkeit der Aktiengesellschaft abzustellen und diese mit wirtschaftskriminalistischen Beweisanzeichen zu belegen. Denn unbenommen der in der Rechtsprechung anerkannten Zulässigkeit dieser Vorgehensweise im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen einer Insolvenzverschleppung gem. § 15a InsO, greift sie für den Tatbestand des Betruges nach § 263 StGB nach Ansicht des Senats zu kurz: Die konkrete Feststellung des Werts der Rückzahlungsansprüche (nebst Zinsforderung) im Zeitpunkt der Vermögensverfügung ist unabdingbar und erfordert vielmehr eine Darstellung des vorhandenen Unternehmensvermögens sowie eine nach wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungsverfahren zu beziffernde und in den Urteilsgründe dargelegte Auswertung der zu prognostizierenden Unternehmensentwicklung. Als zusätzlicher Mangel wird dem LG – ganz nebenbei – überdies die fehlende Begründung zur Bestimmung des Stichtages der Zahlungsunfähigkeit attestiert.
Für die Schadensfeststellung in Anlagebetrugsfällen reicht jedenfalls nicht aus, dass für Anleger eine nur geringe Aussicht besteht, nach dem Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit den Nennbetrag der Aktie vollständig zurückzuerhalten. Allein der Umstand, dass im Rahmen eines später geführten Insolvenzverfahrens der Aktiengesellschaft keine ausreichende Insolvenzmasse zur Gläubigerbefriedigung zur Verfügung stand, ist kein hinreichender Beleg für eine fehlende Werthaltigkeit der Rückzahlungsansprüche zum – maßgeblichen – Zeitpunkt der Vermögensverfügung und vermag daher keinen daraus folgenden Schaden i.S.v. § 263 StGB zu belegen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Aktiengesellschaft über Immobilienvermögen in einer ihre Verbindlichkeiten weit übersteigenden Höhe verfügte. Auch die Feststellung, die Aktiengesellschaft hätte durch die Zurückführung von Bankdarlehen weitere freie Liquidität eingebüßt, rügt der BGH unter Hinweis auf das Fehlen jedweder Feststellungen zu etwaigen Bankguthaben.
Die Entscheidung des 1. Strafsenats zeigt sehr deutlich, dass im Rahmen von § 263 StGB auch angesichts komplexer wirtschaftlicher Bewertungen eine präzise Schadensbestimmung unabdingbar ist. Dabei weist der BGH ausdrücklich darauf hin, dass die dafür erforderlichen Prognosen im Zweifel mittels sachverständiger Hilfe zu erfolgen haben. Dies entspricht der Linie. die das Bundesverfassungsgericht in seinen den Vermögensschaden konkretisierenden Entscheidungen vorgegeben hat: Der Schuldspruch setzt eine den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechende Bezifferung und Darlegung des Schadens voraus. Dabei sind statistische Grundlagen und probabilistische Annahmen der jeweiligen Fallkonstellationen anzupassen sowie im Falle prognostischer Berechnungen Verlustwahrscheinlichkeiten zu erläutern (BVerfGE 130, 1).
Bemerkenswert an der Entscheidung ist überdies, dass der 1. Strafsenat dem LG für die erneute Verhandlung zusätzlich eine nicht kurze Liste an Hinweisen – allein auf tatbestandlicher Ebene – mit auf den Weg gibt: Denn neben den fehlenden Feststellungen zum Stichtag der Zahlungsunfähigkeit mangelt es dem Urteil an differenzierenden Ausführungen zum vertraglich vereinbarten respektive tatsächlichen Rücknahmedatum der Aktien sowie erkennbaren Unterscheidung, in welchen Fällen die Drittgesellschaft einerseits und die Aktiengesellschaft andererseits als Zedentin tätig wurden.
Rechtsanwältin Celina Serbest